Jahr 351 nach dem Götterkrieg, Sommer
Merun, Hauptstadt des Kaiserreichs
Giræsea erwachte in eine Welt, die grausamen Spaß daran fand, sich vor ihren Augen zu drehen und wenn sie diese zu lange offen hielt - bei dem vergeblichen Versuch, klar zu sehen - wurde ihr dabei übel. Also ergab sie sich und ließ sich zurück auf ihr Kissen fallen. “Verflucht…” Sie schloss die Augen wieder und lag still da. Sollte der Tag noch etwas auf sie warten. Sie lauschte. Und hörte nur ihren eigenen Atem. Älyan war fort. Giræsea rollte sich auf die Seite und sah auf das leere Kissen. Wo sie wohl gerade war? Sie strich mit ihren Fingern über den rauen Stoff. Hoffentlich ließ sie sich nicht dabei erwischen, wenn sie etwas dummes tat. Bei dem Gedanken wurde ihr warm ums Herz und sie musste lächeln. Natürlich würde sie etwas dummes tun und Giræsea freute sich schon auf die Geschichte. Erzähl mir nachher davon, dachte sie.
Die Welt tanzte noch immer um sich selbst, ihr Kleid Schatten und Licht und Holz und Stein und das Laken neben ihr und das Wachs der Kerze. Giræsea schloss ihre Augen wieder und versank in der wohligen Wärme des unbequemen Bettes. Trotz allem glücklich. Und trotz allem war sie zufrieden, wie der gestrige Tag verlaufen war. Sicher war es knapp gewesen, doch das war ein Söldner der Kurr weniger. Und wenn sie auch nur ein winziges bisschen Glück hatten, waren sie in weniger als einem Fünftag fort von hier und wieder schwieriger zu finden. Götter, sie würde diese Stadt nicht vermissen. Sie verstand nicht, wieso es so viele Seelen nach Merun zog. Es war die größte Stadt des Kontinents und sie konnte nichts Gutes daran finden. Dicht gedrängte Häuser überall, gebaut nach oben und nach unten und in die Breite, so weit es die Mauerringe zuließen, bevor sie anfingen miteinander zu verwuchern. Tausende von tausenden von Menschen und Zwergen und Felin und alle rannten im endlosen Strom ihrem Leben hinterher. Endloser Tag– die Nacht verbannt durch immer-brennende Laternen und Fackeln, und doch gab es ganze Teile der Stadt, deren Bewohner nie das Tageslicht sahen. Dort landeten all jene, denen in Merun die Sonne nicht vergönnt war oder jene, die suchten, sich im Schatten zu verstecken. Sie gehörte zu letzteren. Und dennoch war sie entdeckt worden. Naja, es war nicht mehr wichtig. Bald würden sie fort sein.
Mühsam setzte sie sich auf und strich sich die Haare aus dem Gesicht. Sie wusste nicht, wie Älyan es geschafft hatte, schon so früh schon munter genug zu sein, ohne eine Spur zu verschwinden. Sie hatte doch die Nacht zuvor ebenso mit ihr gefeiert. Sie wussten endlich, was ihr nächstes Ziel war; sie hatten Grund genug dazu gehabt. Und Gelegenheit. Eine Flasche mit mysteriösem Inhalt und ein unbequemes Bett, es hatte ihnen gereicht. Es war mehr, als ihnen die Straße geboten hatte. Sie kostete ihre Lippen auf einen verbleibenden Geschmack der vergangenen Nacht und wurde enttäuscht.
Sie strich erneut eine Strähne aus ihrem Gesicht, die nicht an ihrem Platz bleiben wollte. Dann seufzte sie und suchte nach dem Ende ihres Zopfes. Sie fand das Lederband und löste den Knoten. Thorgest hatte sich solche Mühe gegeben, doch jetzt begann sich der Zopf aufzulösen. Und in der Stille und dem Frieden ihres Zimmers half sie ihm auf seinem Weg. Perlen aus Metall und Holz glitten durch ihre Finger und sie legte sie auf das Bett. Dann folgte das gelbe Band, das zwischen ihre Haare geflochten war. Mit noch trägen Fingern löste sie den Zopf, Strang um Strang, Windung um Windung. Hinauf zu ihrem Kopf, dann entlang ihrer Schläfen. Es war ein einfacher Moment der Stille und des Friedens, ein Moment, der nichts mit ihrer Suche zu tun hatte, nichts mit ihrer Flucht. Ein Augenblick nur ohne das Gedränge auf den Straßen oder Märkten, ohne den Lärm und - redete sie sich ein - ohne fürchten zu müssen, dass ihr jemand ein Messer zwischen die Rippen treiben wollte.
Sie strich sich die Haare auf die linke Seite, stand auf und trat an die Waschschüssel heran. Sie war froh, dass sie sich zumindest ein paar Annehmlichkeiten leisten konnte, auch wenn nach Monaten auf der Straße ihre Mittel allmählich erschöpft waren. Sie dachte an die Heimat, die sie wahrscheinlich nie wieder sehen würde, als sie sich das Gesicht wusch. Vermisste sie das Sandmeer? Wie der Sand in der untergehenden Sonne glitzerte, wenn ein Windhauch ihn davon trug? Gemeinsam um ein Feuer zu sitzen und Geschichten zu hören und zu erzählen? Ihre Familie? Bereute sie, gegangen zu sein? Sie im Dunkeln gelassen zu haben? Vielleicht – Es war schwer, sich dieser Frage zu stellen. Aber es war besser so; Thorgest hatte recht: “Was hättest du ihnen gesagt? Du hast getan, was du für das Richtige hältst und so wirst du ihnen helfen.” Oh, wie sie hoffte, dass er recht hatte. Fünf Winter war es jetzt her, dass sie ein letztes Mal zu den Sætteni zurückgekehrt war und sie dann für immer verlassen hatte. Ihre Träume hatten ihr den Weg gewiesen. Fort von der Heimat in die Fremde. Kein Ziel; kaum mehr als eine Richtung. Und sie hatten ihr eine schreckliche Vorahnung geschenkt. Und jetzt waren die Eisenwälder überrannt, niemand wusste, wie es um die Steppe stand und es gab erste Sichtungen im Sandmeer. Sie wusste nicht, was ihre Rolle in diesem Stück sein sollte.
In dem kleinen, milchig-trüben Spiegel sah sie ihr Gesicht. Ein müder Ausdruck auf kantigen Zügen aschgrauer Haut. Spitze Ohren ragten zwischen schwarzen Haaren hervor. Über ihre Unterlippe, ihr Kinn und ihren Hals hinunter zog sich eine schwarze Linie, die kurz über ihrer Brust spitz zulief. Sie und die Verzierungen auf ihren Wangen waren eine Erinnerung an ihre Heimat– gestochen, kurz nachdem sie den Entschluss gefasst hatte, diese zu verlassen. Wie schwarze Strahlen einer Sonne rahmten sie ihre schmalen Augen ein. Sie war eine Sætteni und sie würde es tragen. Zwei Paar Stoßzähne standen links und rechts in ihren Mundwinkeln, ihr Stolz, ein Zeichen von Varniths Wohlwollen. Giræsea gab nicht viel auf die Götter, doch sie würde ihren Segen annehmen, wenn er ihr so geboten wurde. Den Schmuck an ihrem Nasenrücken dagegen hatte sie sich verdient. Zwei Paar kurze Dornen aus Metall stachen zu beiden Seiten kurz unterhalb ihrer Augen aus ihrer Haut. Das erste hatte sie erhalten, nachdem sie sich ihrer Mandara unterzogen hatte. Als einzige von dreiundzwanzig hatte sie überlebt. Eine Tragödie, von der man in ihrem Stamm noch bis zu ihrer Abreise ab und an gesprochen hatte und vermutlich auch heute noch tat. Es war üblich, dass es zumindest die Hälfte derer schaffte, die sich dieser Prüfung unterwarfen. Sie alle hatten damals ihr Leben in die Hand des Sandmeeres - die Hand der Götter - gegeben und auf ihr gerechtes Urteil vertraut. Tagelang war sie auf sich gestellt durch die Wüste geirrt, in ihr nur der Gedanke, wie stolz ihr Stamm sein würde, wenn sie zurückkehrte. Bis er schließlich langsam geschwunden war. Doch sie hatte bewiesen, dass sie würdig war. Hatte ihr Leben Stück für Stück dem Sandmeer abgerungen, hatte gelernt, allein zu überleben. Und sie hatte gelernt, den Wert einer starken Gemeinschaft zu schätzen. Zehn eisige Nächte hatte sie auf dem Sand verbracht, alleine und ohne zu wissen, wo sie war. Am elften Tag war sie dann zwischen zwei Zelten hindurch in den Kreis gestolpert und dort vor den Mitgliedern ihres Stammes zusammengebrochen. Seit sie dort draußen ihre Augenbinde abgenommen hatte, hatte sie kaum gegessen. Insekten, Spinnen, Mäuse, Wurzeln, was immer sie gefunden hatte. Sie hatte sie alle roh gegessen. Ihre Eltern hatten ihr gezeigt, was sie tun musste, um zu überleben. Doch sie hatte sich nach dem einfachen Mahl verzehrt, das einer erfolgreichen Jagd folgte. Wenn der Trupp zurückkehrte und einen Kadaver hinter sich her zog, der den Stamm für eine Woche versorgen würde. Sie hatte sich nach Milch gesehnt. Einem einfachen Becher Milch. Sie hätte sogar auf Gewürze und Honig verzichtet. Ihr einziges Glück in dieser Zeit war, dass sie am zweiten Tag Wasser gefunden hatte. Damit hatten ihr die Götter ihre Gunst gezeigt und sie hatte überlebt, wo andere gestorben waren.
Einen Winter nach ihrer Rückkehr hatte sie dann ihren ersten Wahrtraum gehabt.
Über die zweiten, goldenen Dornen wollte sie nicht nachdenken. In ihrem Stolz lag zu viel Schmerz. Sie wandte ihren Blick ab, bevor sie die Züge ihrer Mutter in ihren eigenen sehen konnte.
Sie seufzte und trat von der Schale zurück, um sich in ihrem Zimmer umzusehen. Die Flasche, die ihnen am Vorabend noch gute Gesellschaft geleistet hatte, fand sie auf ihrem Arbeitstisch zwischen einzelnen Bögen Pergament – das Werk der letzten Nacht, als sie mit Schweiß auf der Stirn und einem rasenden Herzen erwacht war. Die Flasche war noch halb voll, also verkorkte Giræsea sie wieder und stellte sie neben ihren Packen zu dem noch immer leeren Schrank. Das Pergament sammelte sie, setzte sich auf den Stuhl und besah sich ihre Zeichnungen einzeln. Es hatte ihr Leid getan - tat es noch immer - dass sie Älyan geweckt hatte, als sie sich mit einer Kerze an den Tisch gesetzt und mit der Arbeit begonnen hatte.
Den ersten Bogen legte sie auf den Tisch, ohne groß darüber nachzudenken. Sie wusste, was darauf zu sehen war, hatte es schon unzählige Male gezeichnet. Augen. Hunderte von Augen. Nichts blieb mehr von dem Pergament darunter, alles war übersät davon. Eine Masse aus weichen, dicht gedrängten, überquellenden, nie-blinzelnden Augen. Sie alle starrten sie an. Giræsea fühlte, wie sie sie beobachten – über sie urteilten. In ihrem Traum war sie zusammengesunken, war unter ihrem unerbittlichen Blick in die Knie gezwungen worden und dann zu einem winzigen Elend verkommen.
Auch die zweite Zeichnung sah sie nicht zum ersten Mal. Sie stand zwischen den Häusern von Arigarðr. Sie spürte die Hitze der Flammen, schmeckte den Rauch. Überall auf den Straßen um sie herum lagen tausende Tote, sie wusste es. Zwerge, Felin, Menschen, Orks, Elfen. Entstellte Leiber, zerfetzte Kleider, leere Augen. Doch sie konnte sie nicht sehen. Giræsea war umringt von Leuten, die ihren Namen riefen, die jubelten, die mit zum Himmel erhobenen Fäusten, Speeren, Äxten ihren Sieg feierten. Sie war schon oft hier gestanden, hatte mit ihnen gejubelt, hatte ihren Triumph in den Morgen geschrien, ihr rot getränktes Schwert in den warm orangenen Himmel gestoßen, ein Spiegel des Turmes, der noch immer stolz gegen den Sonnenaufgang stand. Doch jedes Mal, wenn sie hier stand, nahm die Zerstörung der Stadt zu. Es fühlte sich weniger und weniger wie ein Sieg an und mehr das verzweifelte Abwenden einer Niederlage.
Die dritte Zeichnung wollte sie nicht ansehen. Sie wollte sie in Stücke reißen und verbrennen. Sie hatte es nicht über sich gebracht, sie zu beenden, doch der Traum hatte sich tief in ihr eingebrannt; sie würde ihn nicht vergessen. Mit nur wenigen Linien brach alles wieder an die Oberfläche. Sie hatte das Schwert gehalten, das sie immer gehalten hatte, in Arigarðr, Blut auf seiner Klinge und der Griff fest zwischen ihren Fingern. Doch sie hatte es nicht gen Morgensonne recken können in ihrem Triumph. Und als sie hinab gesehen hatte, war seine Klinge tief in einem Leib vergraben. Entsetzt hatte sie das Schwer losgelassen, als eine schwache Hand nach dem Stahl gegriffen hatte, der aus ihrem Bauch ragte. Zitternd, vornüber gebeugt, kein Atem mehr, der ihre Brust hob und senkte, war die Figur auf Knien gesessen. Giræsea hatte sie sofort erkannt. Natürlich hatte sie sie sofort erkannt. Sie war auf ihre Knie gefallen und hatte Älyans Gesicht zwischen ihren blutverschmierten Händen gehalten.
Sie war schweißgebadet aufgewacht und mit einem Herzen, das gedroht hatte, aus ihrer Brust zu springen. Sie hatte hinübergesehen zu Älyan, um sich zu versichern, dass sie noch da war, dass sie noch am Leben war, dass sich ihre Brust noch hob und senkte. Sie war dagesessen und hatte dem Atem ihres Herzens gelauscht, bis der Sturm und das Donnergrollen in ihrer Brust einer sanften Brise gewichen war. Sie hatte den Drang widerstanden, Älyan zu berühren, sicherzugehen, dass sie wirklich echt war; sie hatte sie nicht wecken wollen.
Nachtmutter, warum quälst du mich so?
Als sie dann endlich aufgestanden war, um ihre Träume auf Pergament zu bannen und die Kerze angezündet hatte, hatte sie Älyan schließlich dennoch geweckt. Eine geflüsterte Bitte um Entschuldigung und ein Kuss auf ihre Stirn und die Elfe war bald wieder eingeschlafen.
Es folgten weitere Skizzen und Szenen, die sie noch nicht gesehen hatte, deren Inhalt ihr aber nicht fremd war. Er begleitete sie seit Jahren. Die Eisenwälder in ihrem Todeskampf. Metallene Gerippe vergangener Riesen, verwelkte Blätter, Erde, auf der nichts mehr wuchs. Kadaver. Leichen und noch-nicht-Leichen. Fäulnis ohne ihre bunten Farben.
Nur ein neuer Schauplatz hatte sich unter all die bekannten gemischt. Sie meinte, die Stadt zu kennen, irgendwo tief in einer Windung ihrer Erinnerungen. Sie war sich sicher, dass sie schon einmal dort gewesen war. Irgendwo im Sandmeer. Sie würde es mit Thorgest besprechen, er war gut in solchen Dingen. Was sie mehr beunruhigte, war der Sturm, der sich auf die Mauern zu wälzte, die Wand aus braun und gelb und rot, aus Staub und Sand und die alles unter sich begraben würde, aber - Scheiße - welcher ihrer Träume beunruhigte sie nicht?
Sie legte den Stapel Pergament zurück auf den Tisch und setzte sich auf ihr Bett. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Lange saß sie da und versuchte, ihre Gedanken zu ordnen, einen Sinn darin zu finden, etwas, woraus sie eine Handlung ziehen konnte. Und schließlich traf sie eine Entscheidung. Sie würde einen Schritt nach dem anderen gehen. Sie würde zu Ende bringen, wozu sie nach Merun gekommen waren. Wenn sie damit fertig war, konnte sie sich weitere Sorgen machen. Und sie traf eine zweite Entscheidung: Sie würde niemals nach Arigarðr gehen. Sie würde Älyan und Thorgest erklären müssen, wieso, doch ihr würde etwas einfallen. Und mit dieser Entscheidung in ihrem Herzen nahm sie das Pergament, entzündete die Kerze, die ihr noch in der Nacht zuvor das Licht für ihr Werk gespendet hatte, und verbrannte es. Sie wollte nie wieder sehen, was schwarze Kohle dort auf hellem Grund geschaffen hatte.









![Necrosis (Weltentod I) [Deutsch]](https://us-a.tapas.io/sa/80/41cb7f29-d0cc-48e5-85f2-518d3ac8afe0_z.png)
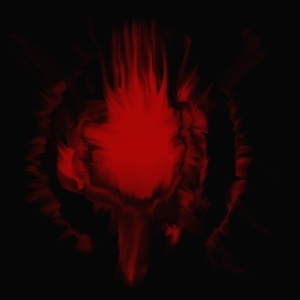
Comments (0)
See all